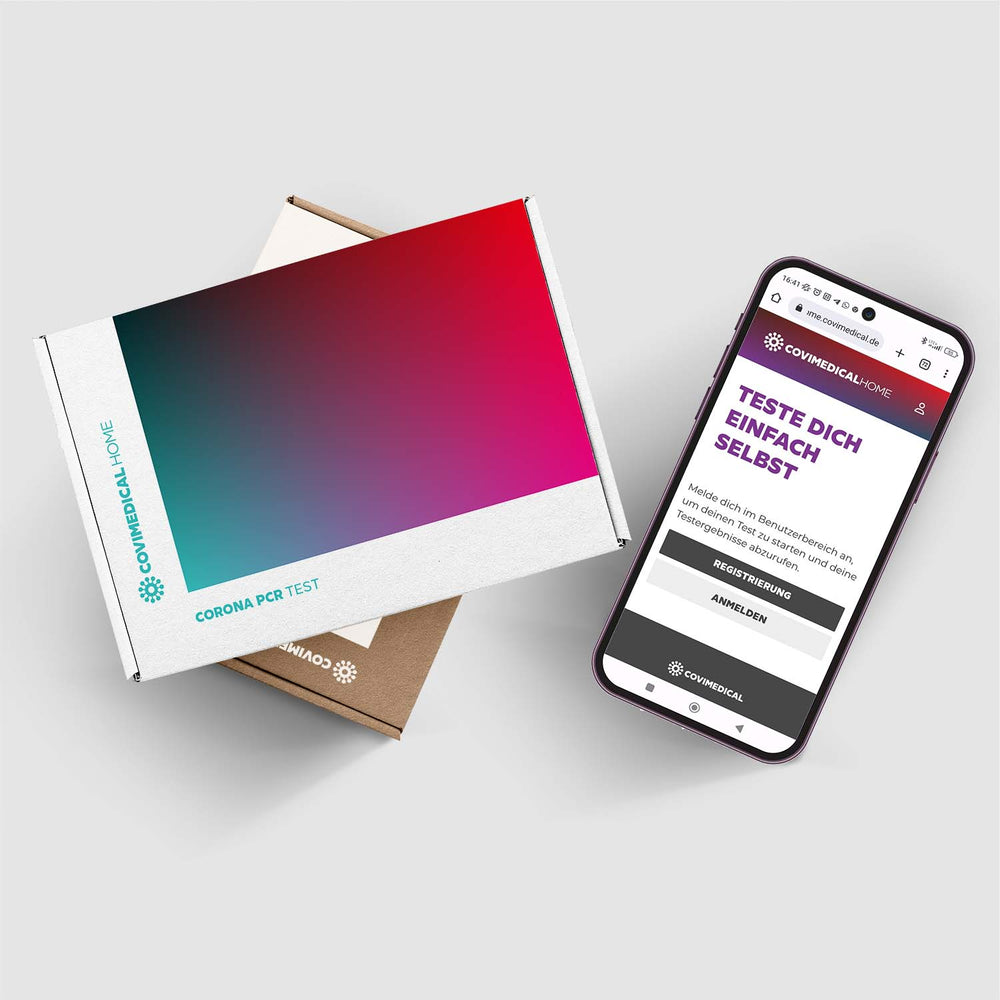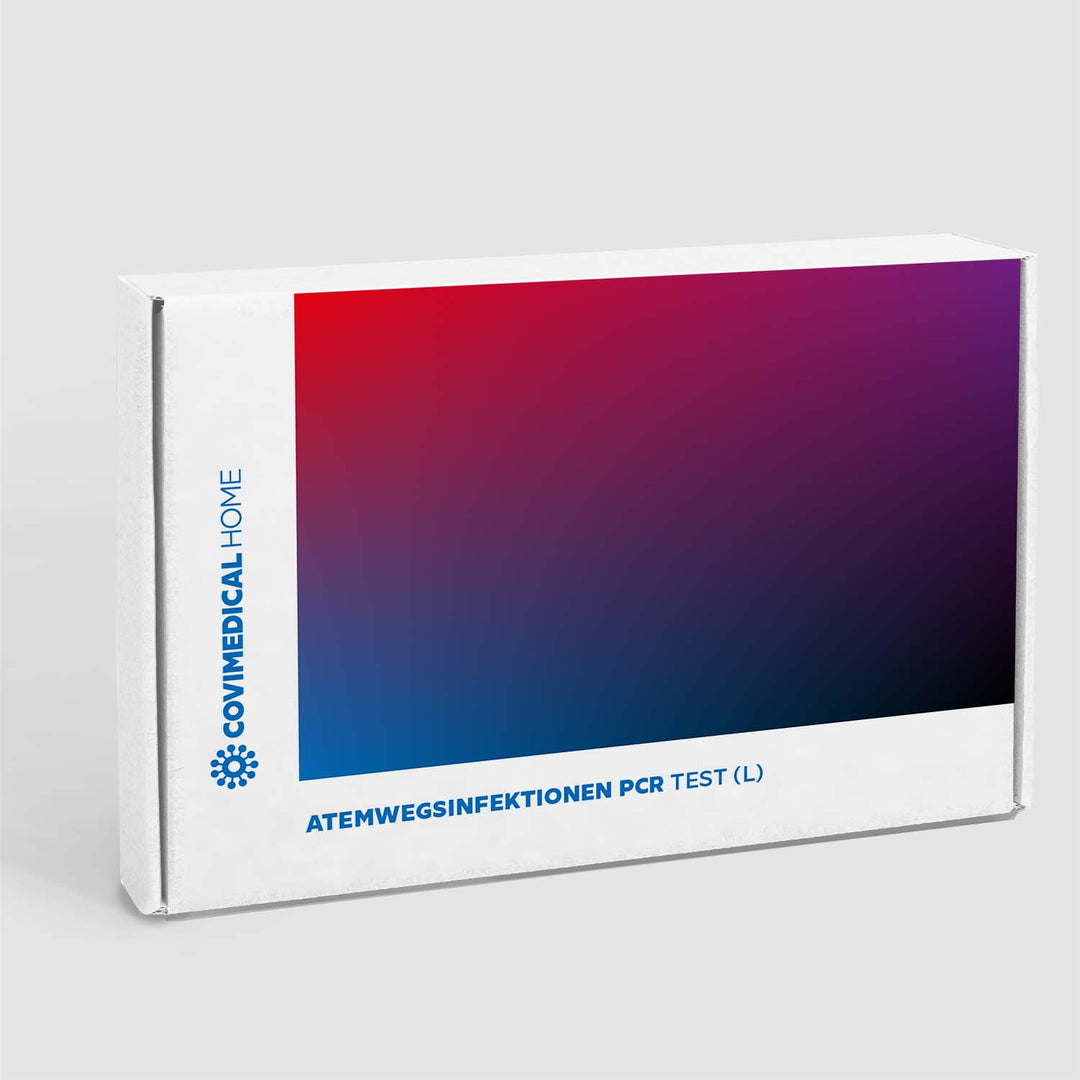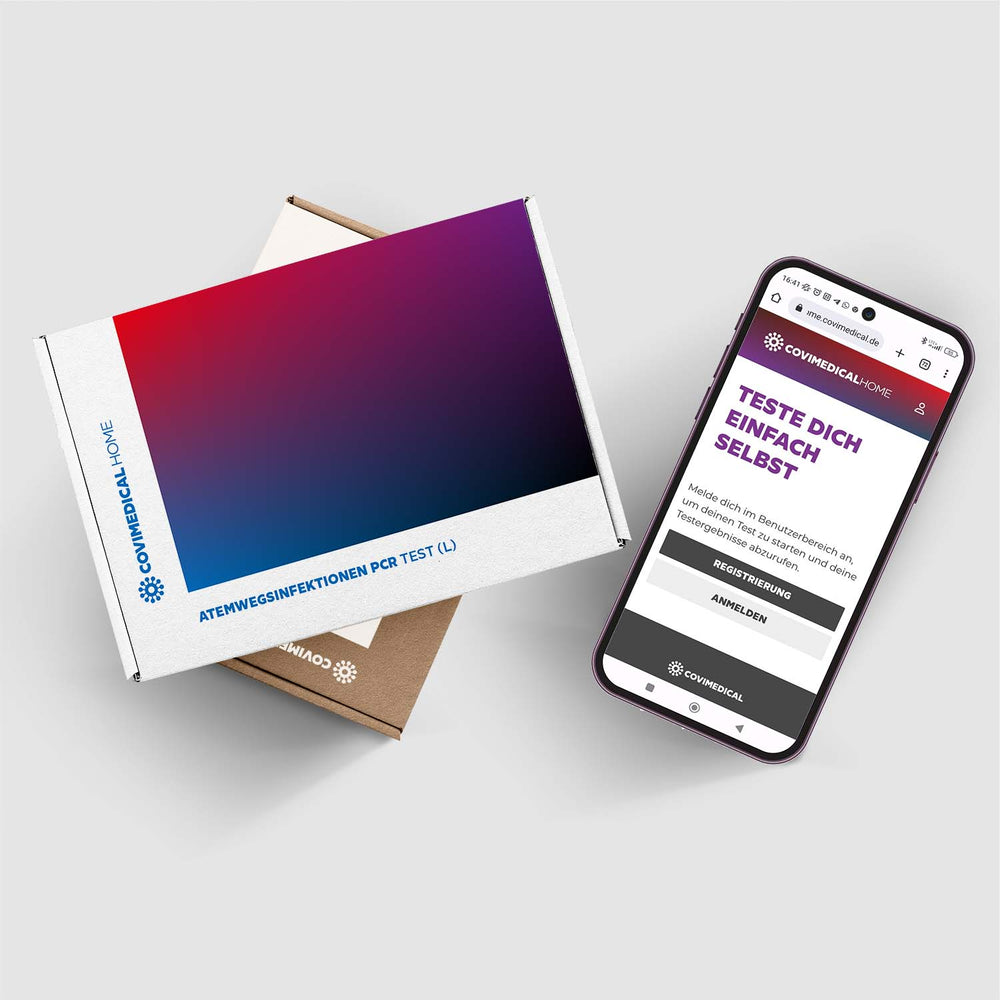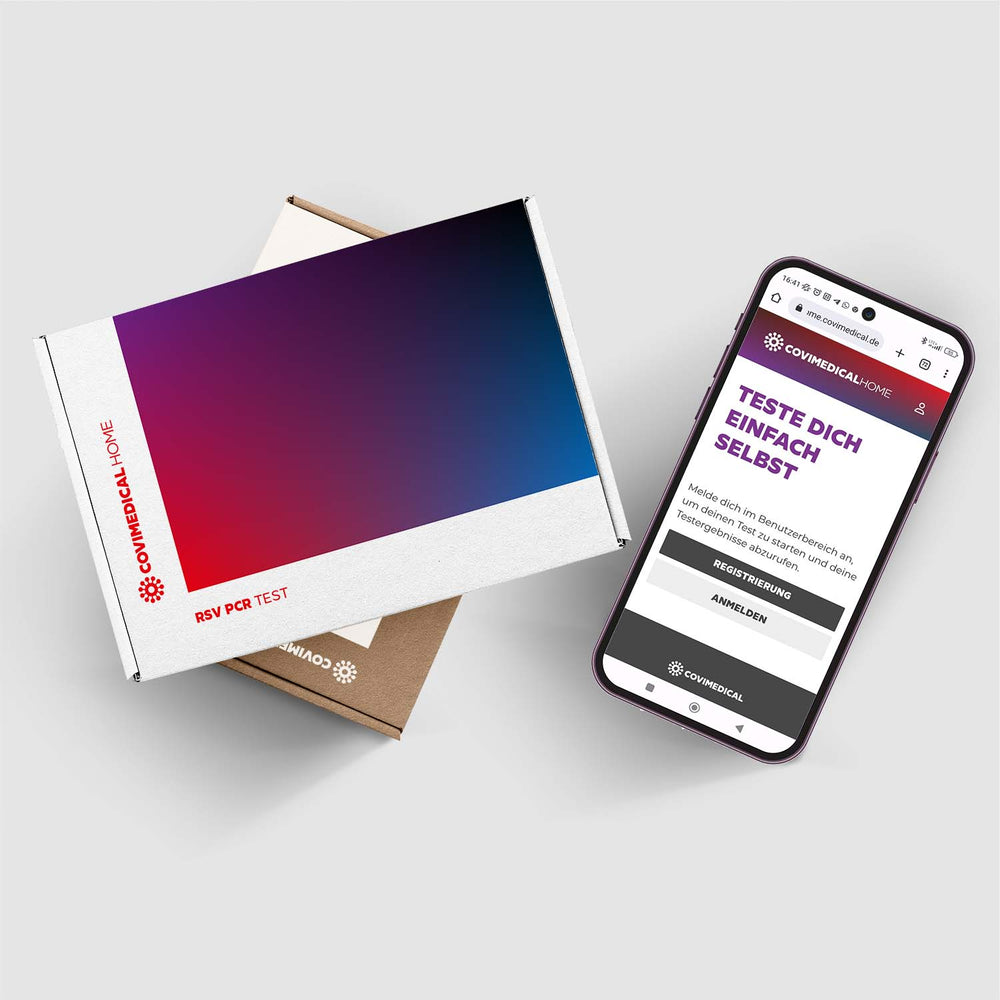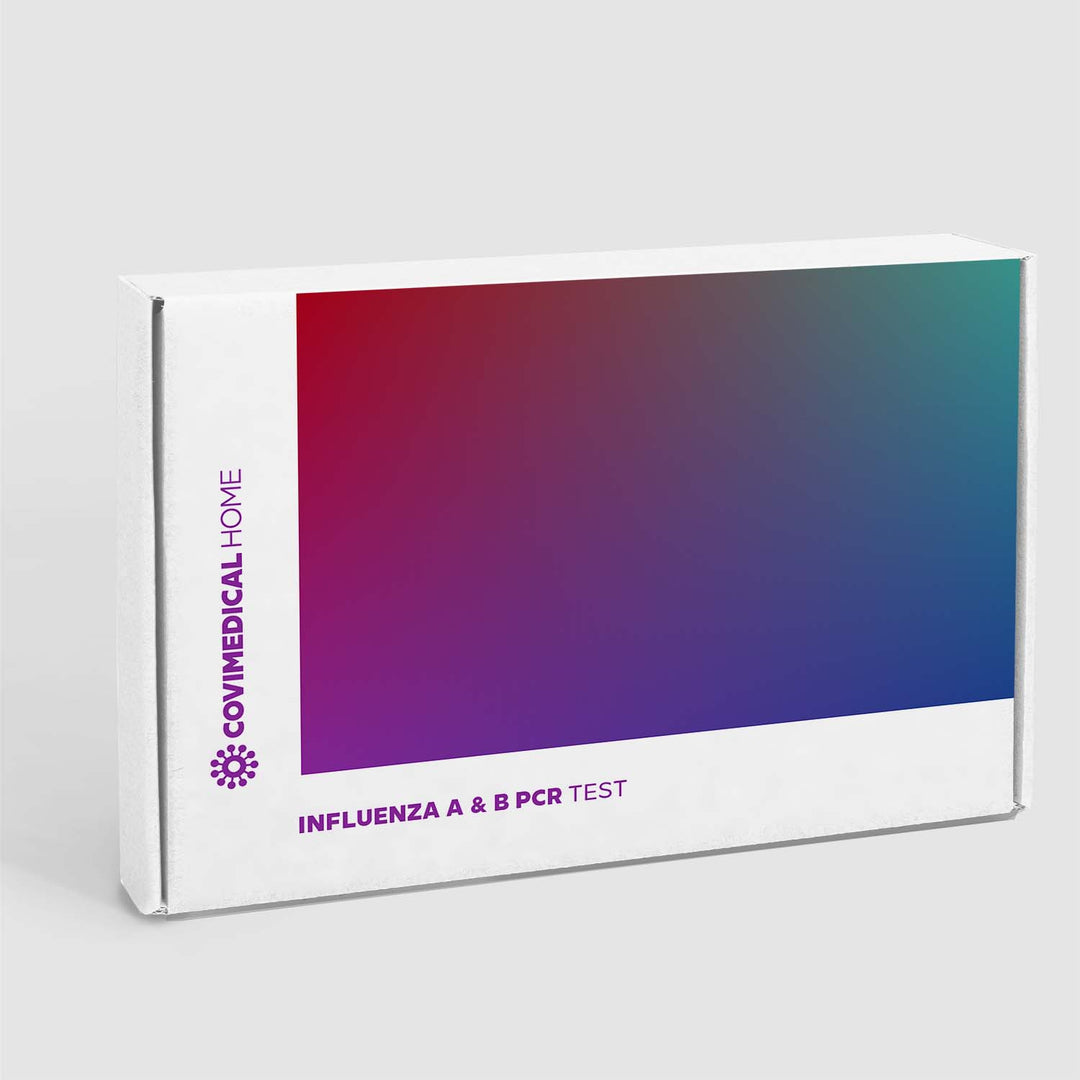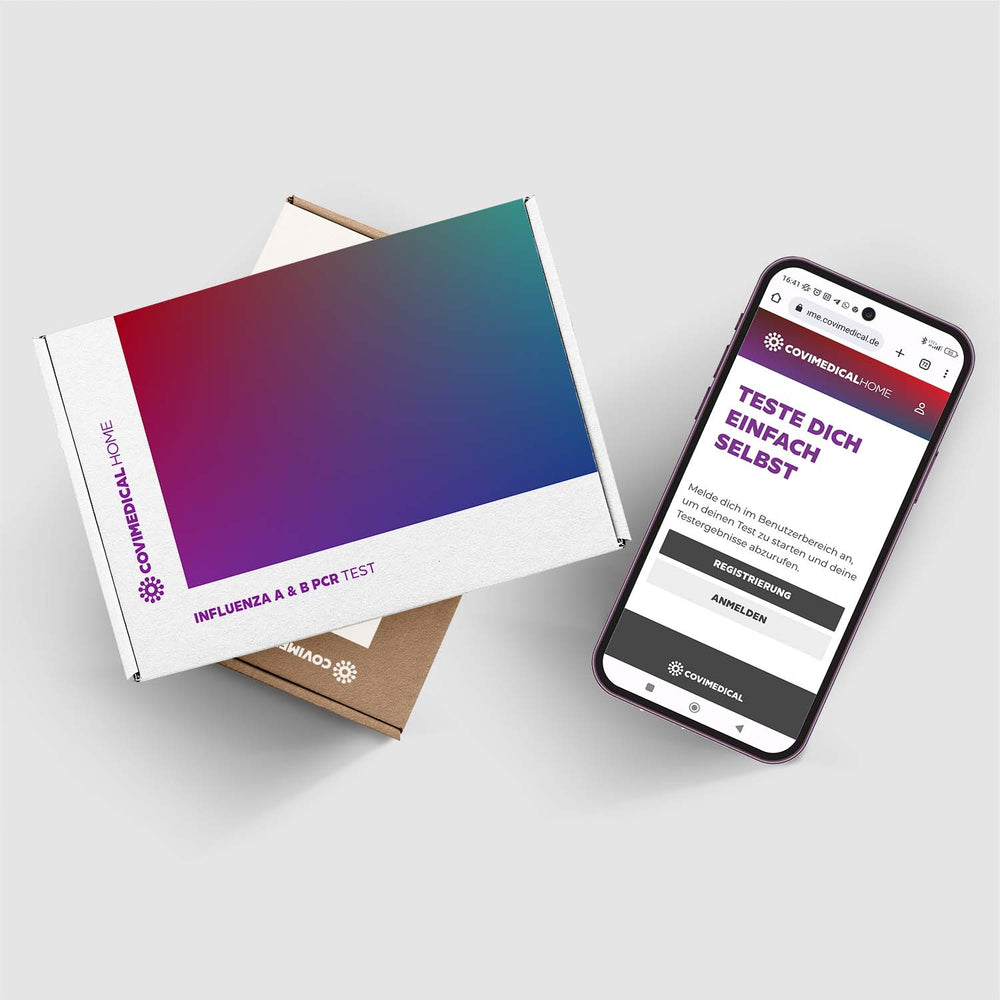Corona hält die Welt in Atem
Als zu Beginn des Jahres 2020 in den Nachrichten von einer schweren Epidemie in China die Rede war, ahnte wohl niemand, wie nachhaltig SARS-Cov-2 die ganze Welt verändern würde. Das Corona-Virus, welches schwerwiegende Erkrankungen der Lungen hervorrufen kann, bestimmt seitdem große Teile des öffentlichen und privaten Lebens der Menschen. Anstelle von Fußballergebnissen, sind Inzidenzwerte, Fallzahlen und ct-Werte Thema Nummer 1. Mittlerweile ist das Virus aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden; dank Hygieneregeln, Tests und Impfstoffen konnte die Gefahr in großen Teilen gebannt werden. Doch Wissenschaftler sind sich sicher: Das Corona-Virus wird uns noch lange begleiten.
Was ist Corona und wie sind die Symptome?
SARS-Cov-2, oder kurz Covid oder Corona, gehört zur Gruppe der Coronaviren. Eine Infektion mit diesem Virus kann Atemwegserkrankungen mit unterschiedlichen Symptomen hervorrufen: Diese reichen von einem einfachen Schnupfen oder grippeähnlichen Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen.

Nach überstandener, akuter Infektion berichten manche Betroffene von Folgeerscheinungen: Das sogenannte Long-Covid-Syndrom verursacht ständige Erschöpfung, Kopfschmerzen und eine Verringerung der sportlichen Leistungsfähigkeit - sogar einfaches Treppensteigen wird zum Kraftakt.
Dabei gibt es nicht nur eine Coronavirus-Variante: Bekannt sind etwa die Alpha-, Beta-, Gamma- und Delta-Mutationen. Manche Varianten sind ansteckender als das ursprüngliche SARS-Cov-2 und verursachen schwerere Krankheitsverläufe. Wissenschaftler beobachten ständig neue Mutationen des Coronavirus.
Wie wird auf das Coronavirus getestet?
Um eine Infektion mit dem Coronavirus sicher nachweisen zu können, wird ein PCR-Test durchgeführt. Dabei wird eine Probe (Nasen- oder Rachenabstrich oder Mundspülung) im Labor ausgewertet. Die Probe wird im Labor bearbeitet, um genetisches Material des Virus (RNA) zu isolieren und damit nachzuweisen.
Der Antigen-Schnelltest erfolgt ebenfalls mittels einer Probe aus dem Nasen- oder Rachenbereich. Der Antigen-Schnelltest, wie der Name schon sagt, liefert nach nur etwa 15 Minuten ein Ergebnis. Diese Testart ist damit zwar weniger zeitintensiv, zeigt aber eine höhere Fehlerquote als PCR-Tests. Die Qualität des Testmaterials und die sachgemäße Probennahme sind für die Ergebnisse der Antigen-Schnelltest von hoher Bedeutung.
Allgemeingültige Zahlen, wie zuverlässig so ein Antigen-Schnelltest ist, gibt es nicht. Kölner Forscher aus Köln haben bereits im Jahr 2022 17 weltweite Studien mit mehr als 6.000 Kindern und acht Antigenschnelltests analysiert. Das Ergebnis: 35,8 Prozent der Tests waren falsch-negativ – es blieb also mehr als ein Drittel der Infektionen bei den getesteten Kindern unentdeckt. Die Quote für richtig-positiv lag immerhin bei 99,1 Prozent. Die Studien stammten aus den USA, Spanien und Deutschland. Schlecht schnitten die Tests bei infizierten Kindern ab, die keine Symptome zeigten: Nur bei 56,2 Prozent war das Ergebnis korrekt.
Eine weitere Testart bei Corona ist der Antikörpertest durch eine Blutprobe. Hier reicht ein Pieks in den Finger, um mit ein wenig Kapillarblut die Konzentration von Corona-Antikörpern zu bestimmen. Ist eine gewisse Anzahl von Corona-Antikörpern im Blut nachweisbar, kann man davon ausgehen, dass der Mensch bereits einmal mit SARS-Cov-2 in Kontakt war. Diese Art von Test kann dann durchgeführt werden, wenn man wissen möchte, wie gut das Immunsystem auf eine potentielle Coronainfektion reagieren wird oder ob der Impfschutz noch besteht. Experten sind sich aber einig: Das Testergebnis liefert keine garantierte Aussage darüber, wie stark oder schwach die Symptome bei einer möglichen Corona-Erkrankung wirklich sein werden. Denn bis heute ist nicht bekannt, wie hoch die Antikörperkonzentration sein muss, um von einem sicheren Schutz zu sprechen.
Wie gefährlich ist das Coronavirus heute noch?
Die Entwicklung der verschiedenen Impfstoffe gegen das Coronavirus war, im Vergleich zu anderen Vakzinen, bemerkenswert schnell: Innerhalb von einem Jahr nach Auftreten der ersten Coronainfektionen im Dezember 2019 wurden mehrere Vakzine entwickelt und weltweit verimpft. Laut RKI lag am 12. März 2023 die Impfquote der vollständig geimpften in Deutschland bei 76,4 Prozent, was einer Zahl von 64.873.659 Menschen entspricht.
Diese relativ schnelle Entwicklung ist vor allem auf die akute Bedrohung durch das Virus zurückzuführen: Eine enge Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen, Wissenschaft und Regierungen sowie mehr finanzielle Mittel für Forschung und Entwicklung waren Konsequenzen der hohen Priorisierung. Zahlreiche medizinische Studien sicherten eine gute Evidenzbasis, um die Wirksamkeit der Impfstoffe zu sichern.
Heute hört man kaum noch etwas über das Thema Corona. Wie gefährlich ist das Virus dann heute noch? Die ständig neuen Corona-Mutationen erfordern weiterhin Forschung und Entwicklung, um die Wirksamkeit der Impfstoffe zu gewährleisten. Es gibt keine 100%-Garantie, dass eine Impfung vor einem schweren Infektionsverlauf schützt.
Auch für Menschen, die Vorerkrankungen der Atemwege oder ein geschwächtes Immunsystem haben, sowie für ältere Menschen bleibt das Coronavirus gefährlich. Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser zählen weiterhin zu den vulnerablen Gruppen und Bereichen, die durch Tests geschützt werden können.

Erst Karneval, dann Corona
Immer wieder wurde betont, dass Impfungen zwar vor schweren Corona-Verläufen schützen können, aber nicht vor der Ansteckung an sich. Dass Menschenansammlungen immer noch Inzidenztreiber sind, sieht man an den Zahlen des RKI, die nach der vergangenen Karnevalssession veröffentlicht wurden. Kurz gesagt: Wo viele Menschen gefeiert haben, schnellten die Coronazahlen wenige Tage später in die Höhe. Eine Zunahme der Inzidenzwerte sei in „Regionen mit stärkeren Karnevalsaktivitäten zu beobachten“, heißt es im RKI-Wochenbericht Anfang März 2023.
Demnach setzte sich in der ersten Märzwoche ein landesweiter Inzidenzanstieg auf niedrigem Niveau fort: Er wurde auf plus 14 Prozent im Vergleich zur Woche zuvor beziffert. Besonders stark stiegen die Werte jedoch in Rheinland-Pfalz (36 Prozent), Nordrhein-Westfalen (35 Prozent) und dem Saarland (34 Prozent) sowie in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre – allesamt Bundesländer, die für ihre Karnevalshochburgen bekannt sind. Diese Angaben beziehen sich nur auf im Labor bestätigte Corona-Fälle. Die Behörden gehen daher von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus.
Quellen:
Allgemeine Infos zum Testen | Zusammen gegen Corona COVID-19 Schnelltests: Studie zeigt hohe Fehlerquote bei Kindern | National Geographic Was bringen Covid-19-Antikörpertests? | Apotheken Umschau (apotheken-umschau.de) Mehr Ansteckungen registriert: Erst Karneval, dann Corona | tagesschau.de